Kobaltabbau im Kongo: Hohe Kosten für die Klimawende
Solarpanels, E-Autos und nun auch E-Scooter: Die Nachfrage nach umweltfreundlicher Energie und Mobilität wächst stetig, Klimaschutz wird immer wichtiger. Ein genauer Blick auf die…
Es ist silbergrau, glänzend und heiß begehrt: Das Metall Kobalt gehört zur Gruppe der sogenannten Seltenen Erden, allesamt Rohstoffe, die für vielfältige Zwecke benötigt werden. Elektroautos, Windräder, Displays, Mikrochips, Mobiltelefone – ohne Seltene Erden lassen sich Energiewende, Digitalisierung oder Dekarbonisierung nur schwer verwirklichen.

Kobalt sorgt dafür, dass Laptops, Smartphones und E-Autos nicht so rasch der Strom ausgeht. Kobalt ist zum wirtschaftsstrategischen Rohstoff geworden und aus Lithium-Ionen-Batterien nicht mehr wegzudenken. Bis 2026 soll sich der globale Bedarf an diesem Metall sogar verdoppeln.
Aber: Kobalt wird zu einem beträchtlichen Teil unter fragwürdigen Bedingungen abgebaut. Fast die Hälfte der weltweit vorhandenen Vorräte an dem Metall befindet sich in der Demokratischen Republik Kongo. Hier kommt es beim Abbau zu Menschenrechtsverletzungen, ganze Ökosysteme und damit die Lebensgrundlage vieler Menschen werden durch den Kobalt-Bergbau unumkehrbar zerstört.
Im südöstlichen Kongo wird das Metall meist im Rahmen des sogenannten Kleinbergbaus gewonnen. Dafür schürfen die Arbeiter*innen es unter prekären Bedingungen mit der Hand aus dem Boden. Es fehlt an ausreichender Schutzbekleidung, die Bergleute setzen sich Gesundheits- und gravierenden Unfallrisiken aus. Durch den Einsturz von selbstgebauten Tunneln sind bereits zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO kann Kobaltstaub schwerwiegende Atemwegserkrankungen auslösen. Oft arbeiten auch Kinder und Jugendliche im Kleinbergbau. Sie sortieren und waschen die Materialien und betätigen sich als Träger*innen.
Der industriell betriebene Abbau von Kobalt durch internationale Konzerne führt teils zu massiven Vertreibungen: Anwohner*innen werden wegen des Rohstoffabbaus gewaltsam gezwungen, ihre Wohnorte zu verlassen. Wenn es überhaupt eine Entschädigung gibt, so ist diese zumeist unzureichend. Andererseits ist die Förderung von Kobalt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Kongo. Allein die verschiedenen Aktivitäten im Rahmen des Kleinbergbaus sichern das Einkommen von etwa 20 Millionen Menschen.
© Peter Kreysler
© Peter Kreysler
© Peter Kreysler
© Peter Kreysler
© Peter Kreysler
Misereor setzt sich für ein wirksames EU-Lieferkettengesetz ein, um Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutung, die Gefährdung der Gesundheit von Arbeiter*innen und Umweltbelastungen auch beim Abbau von Kobalt zu verhindern. Zwar tritt bereits 2023 das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in Kraft. Allerdings müssen Unternehmen demnach Menschenrechtsrisiken bei indirekten Zulieferern – zum Beispiel im Bergbausektor – nur dann untersuchen, wenn sie bereits „substanziierte Kenntnis“ über mögliche Verletzungen haben, wenn es also möglicherweise schon zu spät ist. Das deutsche Gesetz verbessert auch die Aussichten von Betroffenen auf Schadensersatz nicht. Misereor fordert gemeinsam mit der Initiative Lieferkettengesetz, dass diese und andere Schwachpunkte auf EU-Ebene behoben werden.
Die Erfahrung zeigt: Es reicht nicht aus, dass sich einige Unternehmen freiwillig um die Achtung der Menschenrechte in ihren Lieferketten bemühen. Es braucht gesetzliche Vorgaben, die von allen Unternehmen umgesetzt werden müssen.
Zur Kampagne
Darüber hinaus müssen Staaten wie die Demokratische Republik Kongo darin unterstützt werden, sich durch Diversifizierung ihrer Wirtschaft unabhängiger von Rohstoffexporten zu machen und die Bodenschätze stärker für die Entwicklung ihres eigenen Landes zu nutzen.
Weitere Informationen zum Kobaltabbau finden Sie in der Studie des Ökumenischen Netzes Zentralafrika (ÖNZ) und des entwicklungspolitischen Netzwerkes INKOTA: Kobalt. kritisch³
Die Misereor-Partnerorganisation CARF (Centre Arrupe pour la Recherche et la Formation) ist ein Zentrum der Jesuiten in der kongolesischen Stadt Lubumbashi. Sie untersucht und dokumentiert, welche direkten Auswirkungen und Folgen der Abbau von Kobalt in der Demokratischen Republik Kongo für die Gemeinden vor Ort und insbesondere für die Kleinschürfer*innen hat.
Laut kongolesischem Gesetz stehen den Kleinschürfer*innen eigene Schürfgebiete zu, wenn sie sich in Kooperativen organisieren. Diese Gebiete werden faktisch jedoch kaum ausgewiesen oder befinden sich an Standorten, die keine hinreichenden Erzvorkommen haben. Außerdem werden die Kleinschürfer*innen oft nur geduldet oder schürfen lediglich illegal auf Konzessionsgebieten von Bergbaufirmen. Dabei kommt es oft zu Gewalt und Menschenrechtsverletzungen.
© CARF
© CARF
© CARF
© CARF
© CARF
Deshalb stärkt CARF die Arbeiter*innen bei der Durchsetzung ihrer Belange. Außerdem verfolgen sie das Ziel, durch lokale, nationale und internationale Lobbyaktivitäten Druck auf staatliche und privatwirtschaftliche Akteure aufzubauen. Damit sollen Verbesserungen im Bereich von Menschenrechten, Umweltschutz und der Wahrnehmung sozialer Verantwortung erreicht werden: Bei der Förderung von Kobalt soll es gerechter zugehen.
High-Tech auf dem Rücken der Armen: Der weltweit zunehmende Wohlstand verlangt nach immer mehr Rohstoffen. Die Kehrseite: Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung.
Zum Themendossier Coltan
Verbrenner raus - Elektromotor und Batterien rein. So malen Automobilindustrie und Verkehrsminister gerne die Zukunft des PKW. Doch die Verheißung ist nicht nur unrealistisch. Sie leistet auch neuem Raubbau an der Natur Vorschub. Zur Dokumentation

Die Studie analysiert den Rohstoffverbrauch der Automobilindustrie und die Auswirkungen auf Umwelt…
Die Studie analysiert den Rohstoffverbrauch der Automobilindustrie und die Auswirkungen auf Umwelt und Menschenrechte. Fazit: Der Ausbau der Elektromobilität ist wichtig, doch auch die Zahl der Autos muss deutlich verringert sowie Menschenrechte und die Umwelt beim Rohstoffabbau besser geschützt werden.
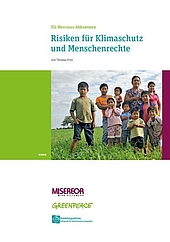
Bereits im Juni 2019 erzielte die EU-Kommission mit den Regierungen der MERCOSUR-Staaten Brasilien,…
Bereits im Juni 2019 erzielte die EU-Kommission mit den Regierungen der MERCOSUR-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay eine „grundsätzliche Einigung“ über ein Handelsabkommen. Nun will die Bundesregierung die Unterzeichnung unter ihrer EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 vorantreiben. In ihrer gemeinsamen Studie warnen Misereor und Greenpeace vor den ökologischen und menschenrechtlichen Folgen. Das Handelsabkommen würde in Südamerika die Expansion von Zuckerplantagen, Sojafeldern und Weideflächen beschleunigen: ausgerechnet die Haupttreiber von Waldzerstörung, Landvertreibungen indigener Völker und Menschenrechtsverletzungen. Die EU will zudem europäischen Unternehmen den günstigen Zugang zu Metallrohstoffen sichern, ohne sie zur Achtung von Umwelt und Menschenrechten zu verpflichten. Die Risiken würden verschärft durch die aktuelle Politik des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro, der Umweltstandards, Klimaschutz, Menschenrechte und die Rechte indigener Völker bewusst missachtet. Die Herausgeber erwarten daher von der Bunderegierung und der EU, dass sie das Abkommen ablehnen.

Die Publikation „12 Argumente für eine Rohstoffwende“ veranschaulicht anhand eindrücklicher…
Die Publikation „12 Argumente für eine Rohstoffwende“ veranschaulicht anhand eindrücklicher Fakten: Wir brauchen dringend eine Wende in der Rohstoffpolitik!
Mit eingängigen Grafiken veranschaulicht die Broschüre, wie stark metallische Rohstoffe unseren Alltag durchdringen, welchen Anteil Deutschland am globalen Rohstoffverbrauch hat und welche Mitverantwortung Deutschland an den vielfältigen Menschenrechts-, Umwelt- und Entwicklungsproblemen trägt, die mit dem Abbau, der Verarbeitung und dem Verbrauch von Rohstoffen einhergehen.

Menschenrechtliche und ökologische Verantwortung in einem Zukunftsmarkt.
Woher stammen die für die…
Menschenrechtliche und ökologische Verantwortung in einem Zukunftsmarkt.
Woher stammen die für die Fertigung der Windkraft- und Photovoltaikanlagen benötigten Rohstoffe und unter welchen menschenrechtlichen und ökologischen Bedingungen werden diese abgebaut? Und: Welche Maßnahmen sind notwendig seitens der Unternehmen, der Politik wie auch der Konsumentinnen und Konsumenten, um Menschenrechtsverletzungen beim Rohstoffabbau zu verhindern.
Die Studie greift diese Fragestellung mit speziellem Blick auf die deutsche Wind- und Solarbranche auf.
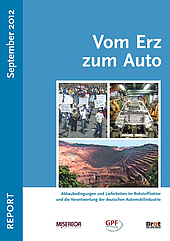
Umweltschäden, Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen gehören in vielen Abbauländern zum…
Umweltschäden, Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen gehören in vielen Abbauländern zum Tagesgeschäft dazu. Diese Studie liefert Informationen zu Abbaubedingungen und Lieferketten und verweist auf die Verantwortung der deutschen Automobilindustrie.
Recherchen, sichtbare Aktionen und politischer Dialog zahlen sich aus. Diese wertvolle Arbeit braucht Unterstützung. Mehr erfahren
Kommentare unserer Spenderinnen und Spender
Ohne Gesetze werden Menschenrechte wohl immer dem Profit untergeordnet. deshalb brauchen wir entsprechende Gesetze!
B. GlaabOhne Gesetze werden Menschenrechte wohl immer dem Profit untergeordnet. deshalb brauchen wir entsprechende Gesetze!
B. Glaabein kleiner Beitrag gegen eine große Ungerechtigkeit
Wir können gemeinsam viel erreichen!
Kurt C.Bitte alles dafür tun, dass Kinderarbeit verhindert wird und sie stattdessen in die Schule gehen können!
Politische Arbeit für Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit ist - gerade im kirchlichen Bereich - unabdingbar.
Alfons Schulte